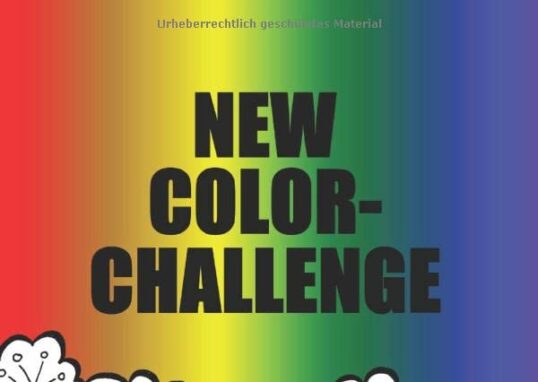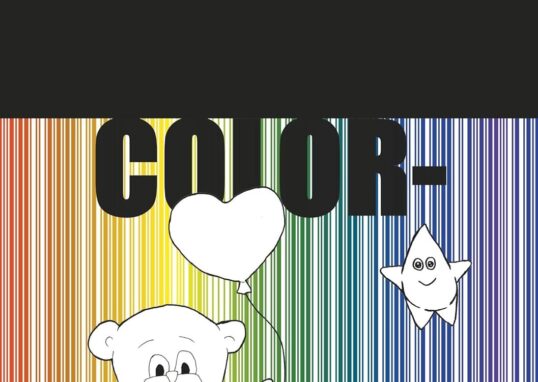Vorschau auf Kapitel 1
Die Morgensonne kroch wie flüssiges Gold über die sanften Hügel von Chiba. Zuerst berührten ihre Strahlen nur die höchsten Baumwipfel und ließen Tauperlen auf den Blättern aufglimmen wie verstreute Edelsteine. Dann sanken sie tiefer und tasteten sich über Wiesen und schmale Feldwege, die sich wie helle Narben durch das satte Grün zogen.
Nebelschwaden lagen schwer über den Feldern, dicht und milchig, als hielte die Welt noch den Atem an. Zwischen den Reispflanzen sammelte sich die Feuchtigkeit der Nacht und aus der Ferne hörte man das leise Plätschern der Bewässerungsgräben. Ein Hahn krähte, erst zögerlich, dann fordernd. Kurz darauf antwortete ein zweiter.
Erst langsam regte sich das Dorf Kumada.
Fensterläden klappten knarrend auf. Eine alte Frau schüttete das Wasser vom Vortag vor ihre Tür und fegte den staubigen Boden. Aus niedrigen Schornsteinen stieg dünner Rauch empor und vermischte sich mit dem Nebel. Der Duft von frisch gebackenem Brot, gekochtem Reis und geröstetem Getreide breitete sich in den engen Gassen aus.
Händler rollten ihre Markisen aus und hievten schwere Holzkisten auf die Tische. Fische wurden auf Eis gebettet, ihre Schuppen noch feucht vom nahen Fluss und im Morgenlicht silbern glitzernd. Stoffbahnen in tiefem Indigo und warmem Ocker wurden mit geübten Handgriffen glatt gestrichen, gefaltet und ordentlich gestapelt.
Ein Gewürzhändler öffnete kleine Leinenbeutel und sofort entfaltete sich ein würzig betörender Duft von Zimt, Pfeffer, getrocknetem Ingwer und fremdländischen Kräutern. Das Aroma mischte sich mit der kühlen Morgenluft und legte sich wie ein unsichtbarer Schleier über den Markt. Es weckte Erinnerungen an ferne Länder und ließ so manchen Kunden unwillkürlich stehen bleiben.
Kinder liefen barfuß über den noch kühlen Boden, lachten und jagten einander zwischen den Ständen hindurch, bis sie von ihren Müttern zurückgerufen wurden. Ein Schmied schob das Tor seiner Werkstatt auf, und kurz darauf erklang das erste metallische Hämmern des Tages.
Über allem lag eine friedliche Gewissheit. Es war ein gewöhnlicher Morgen, getragen von einem vertrauten Rhythmus aus Arbeit, Stimmen und kleinen Sorgen. Niemand ahnte, dass sich hinter dem letzten Streifen Nebel am Horizont bereits etwas Dunkles bewegte und seinen Schatten vorausschickte.
Während das Dorf noch in dieser trügerischen Sicherheit ruhte, hatte der Tag für jemanden längst begonnen, denn in einem kleinen Haus am Rand von Kumada brannte bereits Licht, still und unbeirrbar gegen das fahle Grau der frühen Stunde.
Salyn bewegte sich mit geübter Selbstverständlichkeit durch die kleine Küche ihres Hauses. Ihre langen dunkelroten Haare hatte sie zu einem losen Zopf gebunden, damit sie bei der Arbeit nicht störten, und wenn das erste Morgenlicht durch das Fenster fiel, schimmerten sie wie Glut unter feiner Asche. Ihre lilafarbenen Augen funkelten selbst im schwachen Dämmerlicht lebendig und warm. Trotz der abgetragenen Kleidung und der Schwielen an ihren Händen lag etwas Ungebrochenes in ihrem Blick, eine Kraft, die sich nicht beugen ließ.
Wer sie sah, erkannte, dass in ihr mehr steckte als das Leben einer einfachen Magd, denn es war nicht nur ihre ungewöhnliche Augenfarbe oder die Art, wie sie den Kopf trug, sondern eine stille Entschlossenheit, die sie umgab wie ein unsichtbarer Mantel. Es wirkte, als warte sie auf etwas, das sie selbst noch nicht benennen konnte, als lausche sie einem Ruf, der nur ihr galt.
An diesem Tag jedoch schien selbst die Luft anders zu schmecken, und ein kaum greifbares Prickeln lag darin wie vor einem Sommergewitter, das sich hinter klarem Himmel verbirgt. Die Vögel vor dem Fenster flatterten plötzlich auf, ohne ersichtlichen Grund, und Salyn hielt inne, den Holzlöffel noch in der Hand, als hätte sie ein fernes Flüstern vernommen. Sie lauschte aufmerksam, doch sie hörte nichts außer dem gedämpften Murmeln des erwachenden Dorfes.
Schließlich schüttelte sie leicht den Kopf, nahm den Korb für die Einkäufe und verließ das Haus. Die Sonne war inzwischen höher gestiegen und hatte den Nebel fast vollständig vertrieben, sodass die Hügel von Chiba in klarem Licht dalagen. Auf dem Weg zum Markt begegnete sie Nachbarn, die sie freundlich grüßten. Ein alter Mann nickte ihr mit ruhiger Vertrautheit zu, und eine Bäuerin drückte ihr im Vorübergehen einen Apfel in die Hand. Alles wirkte gewöhnlich und vertraut, als könne nichts diesen Morgen erschüttern.
Dennoch blieb dieses leise Unbehagen in ihr bestehen und legte sich wie ein unsichtbarer Schatten um ihr Herz.
Als sie den Marktplatz erreichte, war das geschäftige Treiben bereits in vollem Gange. Stimmen überlagerten sich wie das Rauschen eines Flusses, Münzen klirrten in ledernen Beuteln, Holzräder knarrten über das Kopfsteinpflaster, und Händler riefen ihre Preise in die kühle Morgenluft. Der Duft von gebratenem Fisch, frischem Brot und scharfem Gewürz lag dicht über den Ständen und mischte sich mit dem Rauch der kleinen Feuerstellen.
Salyn blieb an einem Gemüsetisch stehen und prüfte mit geübtem Blick die Auslage. Sie hob eine Tomate an, wog sie in der Hand und drehte sie prüfend ins Licht, als könne sie in ihrem Glanz die Wahrheit des Tages erkennen. Mit ruhiger Bewegung strich sie über frische Kräuter, rieb ein Blatt zwischen Daumen und Zeigefinger und atmete den herben Duft ein. Alles schien unverändert, als folgte die Welt unbeirrt ihrem gewohnten Lauf.
Da erhob sich ein fernes Donnern, zunächst kaum wahrnehmbar unter den Geräuschen des Marktes. Ein Händler runzelte die Stirn, eine Frau hielt mitten im Wort inne, und mehrere Menschen blickten zum Himmel in der Erwartung dunkler Wolken. Doch dort spannte sich nur ein klares Blau, ungetrübt und gleichgültig.
Das Grollen kam näher und gewann an Gewicht, bis es nicht mehr wie Wetter klang, sondern wie ein schwerer, gleichmäßiger Rhythmus. Der Boden begann zu beben, zuerst zitterten die Wasseroberflächen in Schalen und Eimern, dann vibrierten Körbe auf den Tischen, und ein Stapel Äpfel geriet ins Rollen. Ein Krug kippte und zerbarst auf dem Pflaster, während das Wasser in dünnen Rinnsalen davonlief und im Staub versickerte.
Die Gespräche verstummten allmählich, bis nur noch dieses Dröhnen blieb, das sich wie ein unerbittlicher Herzschlag über den Platz legte. Ein Kind begann schrill zu weinen, ein Hund riss sich los und jaulte, und Tauben stoben in einer grauen Wolke in den Himmel empor.
Dann brachen sie durch die Hauptstraße und teilten die Menge wie eine dunkle Flut, und die schwarzen Reiter erschienen im gleißenden Licht des Morgens. Noch ehe man ihre Gesichter deutlich erkennen konnte, zog etwas anderes die Blicke auf sich und bannte sie mit stummer Gewalt.
Es waren ihre Pferde aus dem Land der Glutus, die man Feuerhufe nannte. Schon aus der Ferne wirkten sie von beinahe unheimlicher Größe, und manche erreichten eine Schulterhöhe von fast zwei Metern. Ihre Körper waren massiv gebaut mit breiter und tiefer Brust sowie einem langen kraftvollen Rücken, der jede Bewegung wie eine geballte Drohung erscheinen ließ. Unter dem dunklen Fell arbeitete die muskulöse Hinterhand mit kraftvoller Präzision, und jeder Schritt ließ den Boden erzittern.
Kein glänzendes Turnierpferd und kein schlanker Fuchs der Chiba hätte sich mit ihnen messen können, denn in ihrer Erscheinung lag nicht nur Stärke, sondern eine rohe Entschlossenheit, die Furcht gebar. Ihr Fell war überwiegend schwarz und matt wie geschwärzter Stahl, während einzelne Tiere weiße Abzeichen im Gesicht oder an den Beinen trugen, deren scharfe Linien im Morgenlicht wie Zeichen eines fremden Willens wirkten. Ihre Köpfe waren groß und dennoch harmonisch geformt mit breiter Stirn und ungewöhnlich ruhigen, fast sanften Augen, was einen verstörenden Gegensatz zu dem Chaos bildete, das sie brachten.
Ihre Hälse waren lang und kräftig und gingen fließend in mächtige Schultern über, die für gewaltige Zugkraft geschaffen schienen. Die Beine waren stark und von dichtem Fesselbehang umgeben, der bei jeder Bewegung aufwallte und im Licht wie flackernde Flammen erschien. Selbst im Stillstand haftete diesen Tieren etwas Majestätisches an, als seien sie nicht nur Träger ihrer Reiter, sondern Boten einer Macht, die sich nun unaufhaltsam über Kumada legte.
Doch jetzt standen sie nicht still.
Mit einem gewaltigen Dröhnen stürmten sie auf den Marktplatz. Unter ihren Hufen flackerte es. Zuerst nur ein Glimmen. Als sie beschleunigten, brach es hervor. Der Feuerlauf entlud sich mit urtümlicher Gewalt, und Flammen leckten unter ihren Hufen hervor, ohne das Pflaster zu versengen. Es war als liefen sie auf unsichtbarer Glut. Ihre Geschwindigkeit war erschreckend. Schneller als jedes gewöhnliche Pferd. Schneller als es möglich schien. Und wo ihre Hufe den Boden berührten blieb kein Abdruck zurück.
„Kakeru!“ schrie jemand und Panik explodierte.
Die gewaltigen Tiere pflügten durch die Menge. Ihre breite Brust warf Menschen zur Seite, ihre Muskelkraft ließ Stände zersplittern. Dennoch wirkten sie nicht wild und nicht rasend. Ihre Bewegungen waren kontrolliert, fast ruhig inmitten des Chaos. Als folgten sie einem Befehl, den nur sie verstanden.
Als Salyn gepackt wurde und der Reiter mit ihr davonjagte, spürte sie unter sich die rohe Kraft des Feuerhufs, die sich in jedem Muskel des gewaltigen Tieres sammelte. Jeder Galoppsprung war federnd und zugleich erschütternd, als würde die Erde selbst unter dieser Macht nachgeben. Der lange Hals streckte sich vorwärts, die mächtigen Schultern arbeiteten mit unbändiger Wucht, und in der Tiefe seines Brustkorbes vibrierte ein Rhythmus, der nicht allein von Fleisch und Blut stammte.
Dann beschleunigte das Tier erneut, und in diesem Augenblick setzte der Feuerlauf ein, als öffne sich ein verborgenes Tor zu einer uralten Kraft. Flammen loderten deutlich unter den Hufen hervor, ohne das Pflaster zu versengen, und der Wind heulte in Salyns Ohren, bis jedes andere Geräusch verstummte. Die Geschwindigkeit wuchs ins Unfassbare, sprengte jedes Maß des Vorstellbaren und verschlang die Welt um sie herum. Die Landschaft zerfloss zu flüchtigen Schatten, Bäume wurden zu dunklen Streifen am Rand ihres Blickes, und kein Hufschlag blieb hörbar zurück, während kein Staub den Boden verließ, als gehorche selbst die Erde einem fremden Gesetz.
Es war, als würden sie über die Welt hinwegfliegen.
Erst im Schutz des Ryô Hains verlangsamten die Tiere ihr Tempo. Das gewaltige Dröhnen ihrer Hufe verlor sich allmählich zwischen den alten Baumstämmen, bis nur noch das schwere tiefe Atmen der Feuerhufe zu hören war. Die Flammen, die eben noch unter ihren Hufen gebrannt hatten, erloschen langsam, als würden sie sich widerwillig in das Innere der Tiere zurückziehen. Weißer Dampf stieg aus ihren Nüstern auf und vermischte sich mit der kühlen feuchten Luft des Waldes.
Im dämmrigen Licht wirkten die Feuerhufe noch größer als zuvor. Ihre beinahe zwei Meter hohe Schulter ragte deutlich über die niedrigen Äste hinaus. Unter dem mattschwarzen Fell arbeiteten mächtige Muskeln und ihre breite tiefe Brust hob und senkte sich ruhig. Der lange kräftige Hals ging fließend in starke Schultern über, geschaffen für enorme Kraft. Um ihre langen Beine fiel dichter Fesselbehang, der im Halbschatten wie dunkle Flammen wirkte. Ihre großen Augen blickten ruhig und klar in die Stille des Hains, beinahe sanft, als seien sie Geschöpfe, die mit der Gewalt ihrer Reiter nichts gemein hatten.
Gerade dieser Gegensatz machte die Situation noch unheimlicher.
Salyn wurde unsanft im Sattel festgehalten, und der Arm ihres Entführers lag hart und unbeweglich um sie, als wäre sie nicht mehr als ein Gegenstand, den man forttrug. Sein Griff war unerbittlich, und jedes Mal, wenn das Pferd den Kopf hob oder die Richtung wechselte, presste er sie fester an sich, damit sie weder rutschen noch sich aufrichten konnte. Die Reiter hielten schließlich im Schatten hoher Bäume, deren Kronen das Licht verschluckten und den Wald in ein gedämpftes Zwielicht tauchten. Der Ryô Hain wirkte fremd und verschlossen, als dulde er keine Eindringlinge und beobachte doch jede ihrer Bewegungen. Kein Vogel sang, kein Insekt summte, und selbst das Rascheln der Blätter war verstummt, als hätte der Wald beschlossen, Zeuge zu sein und nicht einzugreifen.
Die Feuerhufe stampften einmal auf den weichen Waldboden, sodass feuchte Erde unter ihren schweren Hufen nachgab. Ihr dichter Fesselbehang bewegte sich dabei schwer und lautlos, und ein kaum sichtbarer Dampf stieg aus ihren Nüstern auf, obwohl die Luft kühl war. Obwohl keine Flammen mehr unter ihren Hufen brannten, hatte Salyn das unerschütterliche Gefühl, dass das Feuer nur schlummerte und jederzeit wieder hervorbrechen konnte, als warte es geduldig auf einen erneuten Befehl. Sie wagte kaum zu atmen und spürte doch jede Anspannung des Tieres unter sich, als sei sie mit ihm verbunden durch eine unsichtbare Glut.
Dann wurden Stimmen laut, tief und rau, und sie klangen zwischen den Stämmen wider, als kämen sie nicht nur von den Männern, sondern auch aus der Dunkelheit selbst. Sie wurden nicht laut gesprochen, und doch trugen sie eine Schwere in sich, die sich in der Stille des Waldes ausbreitete und wie ein drohendes Versprechen über allem lag. Einer der Reiter wandte sich halb im Sattel, sein Blick glitt prüfend über Salyn, als suche er nach einem verborgenen Zeichen, und schließlich fragte er mit gedämpfter, misstrauischer Stimme: „Warum das Mädchen?“
Es folgte eine angespannte Pause, in der nur das Schnauben eines Pferdes zu hören war und das leise Knacken eines Astes unter einem Huf. Salyn spürte den Atem ihres Entführers dicht an ihrem Ohr, spürte die unbewegliche Härte seines Arms, der sie festhielt, als gehöre sie ihm bereits. Dann antwortete er ruhig, und seine Stimme war kontrolliert und kalt, als spräche er über eine Ware und nicht über ein Leben: „Um Unruhe zu stiften.“ Nach einem kurzen Schweigen, das schwerer wog als jedes offene Drohen, fügte er leiser hinzu: „Und sie ist mein Lohn.“
Ein dunkles kehliges Lachen erhob sich daraufhin und blieb zwischen den Bäumen hängen, als hätte selbst der Wald Mühe, dieses Geräusch zu verschlucken. Salyn spürte, wie sich eine eisige Kälte in ihrer Brust ausbreitete, und in diesem Moment verstand sie mit erschreckender Klarheit, dass es nicht um Lösegeld ging und auch nicht um politische Drohungen oder Machtspiele zwischen den Ländern. Niemand würde mit ihrer Entführung Forderungen stellen, niemand würde verhandeln, denn es ging einzig um die Grausamkeit selbst, um ein Zeichen der Furcht, das man setzen wollte, und um einen Anspruch, der sie wie ein Schatten umfing.
Zwei der Krieger wandten ihre Feuerhufe mit einem kaum wahrnehmbaren Druck der Schenkel und trieben sie wieder an, sodass sich die gewaltigen Tiere in einen schweren Galopp setzten, der den Waldboden erzittern ließ. Ihre massigen Körper bewegten sich mit erstaunlicher Geschmeidigkeit zwischen den dicht stehenden Bäumen hindurch, als wichen selbst Wurzeln und Gestrüpp vor ihrer Kraft zurück, und ihr dichter Fesselbehang strich lautlos über Laub und Erde.
Der dritte Feuerhuf jedoch, auf dem Salyn vor ihrem Entführer im Sattel saß, blieb reglos stehen, während der Arm des Reiters sie weiterhin unerbittlich festhielt. Das Tier hob leicht den Kopf, und seine dunklen Ohren zuckten aufmerksam, doch es setzte keinen Schritt vorwärts. Unter dem schwarzen Fell arbeiteten die Flanken ruhig und kraftvoll, als sammle sich in seinem Inneren eine Energie, die nur auf einen Befehl wartete. Salyn spürte diese angespannte Kraft deutlich unter sich, obwohl das Tier sich nicht bewegte, und gerade diese gebändigte Ruhe erschien ihr bedrohlicher als jeder Galoppsprung.
Die beiden vorausreitenden Krieger beugten sich tiefer in ihre Sättel und gaben ihren Tieren ein deutliches Zeichen, worauf sich deren Lauf beinahe gleichzeitig veränderte. Der schwere Galopp ging in einen schnelleren, geschmeidigeren Rhythmus über, der nicht mehr nur von Kraft, sondern von einer unheimlichen Leichtigkeit getragen wurde. Dann entfachte sich unter ihren Hufen der Feuerlauf.
Flammen loderten auf und schlugen hell unter den Hufen hervor, ohne das Laub zu versengen, und ihr Schein flackerte an den Baumstämmen entlang, sodass der Wald für einen Moment in flammendes Licht getaucht wurde. Ihre Geschwindigkeit wuchs weiter an und überstieg alles, was ein gewöhnliches Pferd zu leisten vermochte, bis ihre Gestalten nur noch als rasendes Leuchten zwischen den Stämmen zu erkennen waren. Wenige Augenblicke später verschlangen Schatten und Entfernung das Feuer, und sie verschwanden in Richtung Andories, während im Hain wieder jene bedrückende Stille zurückblieb, die schwerer wog als jedes Geräusch.
In dieser lastenden Ruhe verharrte nur noch der Reiter mit seinem Feuerhuf zwischen den Bäumen, reglos wie ein dunkler Pfahl im Zwielicht des Waldes. Sein Arm lag weiterhin fest um Salyn, und ohne ein weiteres Wort zu verlieren, zog er mit einem scharfen Ruck die Zügel herum. Das Tier folgte dem Befehl gehorsam und wandte sich von dem Pfad ab, den die anderen genommen hatten.
Er schlug einen schmalen, kaum erkennbaren Weg ein, der tiefer in das Ryô Bergmassiv führte, wo die gewaltigen Felsen wie gebrochene Zähne in den Himmel ragten. Zwischen ihren schroffen Flanken klafften dunkle Höhlenöffnungen, schwarz und reglos, als warteten sie geduldig darauf, alles zu verschlingen, was sich ihnen näherte.
Als er sie vom Pferd riss, verlor Salyn für einen Moment den Halt und stolperte über den unebenen Boden. Seine Hand umklammerte ihren Arm so fest, dass der Schmerz wie ein brennender Ring unter ihrer Haut pulsierte. Hinter ihnen blieb der Feuerhuf stehen, reglos und aufmerksam, die dunklen Augen ruhig und unbewegt, als sei auch er dem unerbittlichen Willen seines Reiters unterworfen und gezwungen, dort zu verharren, gleichgültig gegenüber dem Geschehen zwischen den Felsen.
Der Reiter zerrte Salyn ohne ein weiteres Wort über den steinigen Boden auf die dunkle Öffnung zu, die sich zwischen den Felsen auftat. Scharfe Kanten schnitten durch ihre dünnen Schuhe, und mehr als einmal verlor sie beinahe das Gleichgewicht, doch sein Griff ließ kein Straucheln zu. Vor dem Eingang blieb er kurz stehen, als lausche er in die Tiefe hinein, dann stieß er sie vor sich her über die Schwelle aus nacktem Stein. Mit jedem Schritt wich das fahle Licht zurück, bis es nur noch wie ein matter Streifen hinter ihnen lag.
Die Höhle verschluckte das letzte Licht, das von draußen hereinfiel, und ließ nur einen schmalen, fahlen Schimmer am Eingang zurück, der rasch von der Dunkelheit aufgezehrt wurde. Drinnen war es feucht und kalt, und Wasser tropfte in langsamen Abständen von der Decke, sodass das Echo wie ein ferner Herzschlag durch den Raum wanderte. Der Boden war uneben und steinig, und der matte Schein vom Eingang reichte nur wenige Schritte weit, ehe die Finsternis alles Weitere verschlang.
Dann wandte er sich ihr vollständig zu, und nun sah sie ihn wirklich. Seine Haut war dunkel und mit grauer Farbe beschmiert, glatt wie polierter Stein, und seine breiten Schultern füllten den engen Raum beinahe vollständig aus. Seine Arme wirkten dick wie Baumstämme, und seine Augen glühten nicht nur im Schein des schwindenden Lichts, sondern aus sich selbst heraus, mit einem inneren Glimmen, das hungrig und unruhig wirkte. Er war riesig, ein Koloss, dessen bloße Gegenwart die Luft zu verdichten schien.
„Hab keine Angst“, sagte er leise, doch seine Stimme hallte verzerrt von den Wänden wider und kehrte vergrößert zu ihr zurück, sodass jedes Wort schwerer und bedrohlicher klang, als es gesprochen worden war.
Salyn wich zurück, erst einen Schritt, dann noch einen, bis ihr Rücken den kalten Fels berührte. Der Stein nahm ihr die letzte Wärme, und in diesem Moment begriff sie, dass es keinen Ausweg und kein Entkommen gab.
Er kam langsam näher. Jeder seiner Schritte hallte gedämpft von den Wänden der Höhle wider und verstärkte die bedrückende Enge des Raumes. Sein Blick ruhte auf ihr mit einer prüfenden Kälte, die nichts mit dem Blick eines Kriegers gemein hatte. Es war der Blick eines Raubtieres, das seine Beute mustert und bereits über ihr Schicksal entschieden hat. In seinen Augen lag keine Hast und kein Zweifel, sondern eine ruhige, selbstverständliche Gewissheit.
Er trat noch näher, bis sie seinen Atem auf ihrer Haut spürte, schwer und unangenehm warm. Seine freie Hand fuhr ohne Zögern an ihre Brust, nicht tastend, sondern drückend, als prüfe er die Festigkeit eines Gegenstandes. Der Druck war hart und rücksichtslos, und ein stechender Schmerz durchzuckte sie, sodass ihr die Luft stockte.
Er beugte sich zu ihr hinab. Sein Gesicht kam ihrem gefährlich nahe, und ein kaltes Lächeln verzog seine Lippen. Ohne Eile senkte er den Kopf, als sei es sein selbstverständliches Recht, ihren Widerstand zu übergehen. Seine Lippen streiften ihre Wange und suchten weiter, feucht und aufdringlich, während seine Hand ihren Körper weiterhin festhielt. Der Gedanke, dass er sie küssen wollte, erfüllte sie mit einer Welle aus Ekel, die ihr den Magen zuschnürte.
In seinem Blick lag kein Verlangen nach Nähe, sondern Besitzanspruch. Es war kein Kuss, den er suchte, sondern Unterwerfung.
Seine Hand griff wieder nach dem Stoff ihres Kleides. Die Bewegung war weder ungestüm noch unkontrolliert, sondern von einer beunruhigenden Sicherheit getragen. Er handelte mit der Überzeugung eines Mannes, der keinen Widerstand erwartet und keine Rechenschaft fürchtet.
„Du wirst still liegen.“, sagte er mit gedämpfter Stimme. „Dann wird es schnell vorübergehen.“
Diese Worte trafen Salyn schwerer als jede körperliche Gewalt es vermocht hätte. Sie waren nicht im Zorn gesprochen, sondern in nüchterner Entschlossenheit, und gerade darin lag ihre ganze Grausamkeit.
Salyn spürte, wie ihr Herz heftig gegen ihre Rippen schlug. Ihr Atem wurde flach, und die Luft der Höhle erschien ihr plötzlich kalt und fremd. Ihre Finger krallten sich in den rauen Fels unterer ihr, suchten Halt an der unnachgiebigen Oberfläche. Der Stein war hart und feucht, doch sie klammerte sich daran, als könne er sie vor dem Unvermeidlichen schützen. Ihr Körper verlangte nach Flucht, doch es gab keinen Raum, in den sie hätte ausweichen können.
Seine Hand glitt höher und schloss sich fester um den Stoff ihres Gewandes. Er zog daran mit prüfender Entschlossenheit, als gehöre ihm nicht nur ihr Körper, sondern auch ihre Angst. Sein Schatten fiel über sie und nahm ihr das letzte Licht. Zwischen ihnen blieb kein Spalt, kein Ausweg, kein Zeichen von Erbarmen.
Es war nicht nur der Stoff ihres Gewandes, der unter seinem Griff nachgab, und es war auch nicht allein ihre äußere Fassung, die ins Wanken geriet. Er beugte sich weiter zu ihr hinab, und sein Atem lag heiß und schwer auf ihrer Haut. Der Geruch von Leder, Schweiß und kaltem Metall nahm ihr beinahe die Luft. Seine Nähe drängte sich auf wie eine Last, die ihre Gedanken erdrückte und die Welt auf diesen einen Augenblick zusammenschrumpfen ließ. Salyn presste die Hände gegen seine Brust, doch sie fühlte nur die unbewegliche Härte seiner Gestalt. Seine Kraft war unbestreitbar, seine Überlegenheit schien vollkommen.
Für einen flüchtigen Augenblick überkam sie der Gedanke, dass jeder Widerstand vergeblich sei und dass mit diesem Moment ihr Leben enden würde.
Tief in ihrem Inneren regte sich eine Grenze, deren Existenz ihr nie bewusst gewesen war. Es war eine unsichtbare Schwelle, die sie ihr ganzes Leben in sich getragen hatte und die nun unter roher Gewalt zu weichen drohte. In diesem Augenblick zerbrach etwas in ihr, doch was fiel, war nicht ihr Wille, sondern die letzte Fessel.
Dann schloss sie die Augen, nicht aus Schwäche und nicht aus Resignation, sondern weil in ihr etwas zu erwachen begann, das größer war als ihre Furcht.
Zunächst regte sich nur ein kaum wahrnehmbares Flimmern tief in ihrer Brust, wie eine Glut, die lange unter Asche verborgen gelegen hatte. Dieses Glimmen erlosch nicht, sondern gewann mit jedem Herzschlag an Kraft. Es breitete sich aus, wurde zu wachsender Hitze und schließlich zu einem pulsierenden Strom, der durch ihren ganzen Körper floss und sich nicht länger zurückdrängen ließ.
Das Gefühl war ihr nicht fremd, sondern von einer rätselhaften Vertrautheit, als habe sie unbewusst ihr ganzes Leben auf diesen Augenblick zugesteuert. Die Hitze durchzog ihre Adern wie ein Sturm, der alles hinwegfegte, was sie eben noch gelähmt hatte. Die Angst verschwand nicht gänzlich, doch sie verlor ihre Herrschaft über sie, und aus Furcht wurde Entschlossenheit, aus Entschlossenheit wuchs Kraft.
Ein feines Vibrieren erfüllte die Höhle, zunächst kaum spürbar, dann deutlich wahrnehmbar, als antworte der Fels auf das Erwachen in ihrem Inneren. Staub rieselte von der Decke, kleine Steinchen lösten sich aus den Wänden, und der Boden unter ihren Füßen begann zu zittern. Die Luft selbst schien dichter zu werden und spannte sich wie vor einem gewaltigen Schlag.
Dann brach das Licht aus ihr hervor.
Ein klares, intensives Blau, wie es nur im Kern einer glühenden Flamme entsteht, durchdrang die Dunkelheit der Höhle. Zuerst war es ein Schimmer unter ihrer Haut, dann ein machtvoller Schein, der sich über ihren Körper legte und sie wie ein lebendiges Feuer umhüllte. Das Leuchten war rein und scharf, frei von Rauch und Schatten, und die Finsternis wich vor ihm zurück, als könne sie seiner brennenden Klarheit nicht standhalten.
Das Licht blieb nicht an ihrer Oberfläche. Es durchdrang sie, formte sie neu, ohne ihre Menschlichkeit zu zerstören. Ihre dunkelroten Haare begannen sich im Schein zu verändern, erst an den Spitzen, dann Strähne um Strähne, bis sie in einem tiefen, leuchtenden Blau erglühten. Es war kein mattes Blau, sondern jenes glühende, gefährliche Blau einer extrem heißen Flamme, das Reinheit und Vernichtung zugleich verheißt. Die Strähnen hoben sich, als würden sie von unsichtbarem Wind getragen, und schimmerten wie flüssiges Licht.
Ihr Körper richtete sich auf, nicht durch äußere Bewegung, sondern durch eine innere Erhebung. Sie wuchs, kaum merklich zunächst, dann deutlich, als strecke sich ihre Gestalt ihrer wahren Größe entgegen. Die Enge der Höhle schien ihr nicht länger gewachsen, und doch blieb ihre Form menschlich, klar und unverkennbar. Ihre Gesichtszüge verhärteten sich nicht, sondern gewannen an Klarheit, als würde das Licht in ihr alles Ungewisse fortbrennen.
Hinter ihr jedoch begann sich etwas Neues zu entfalten. Zuerst war es nur ein Leuchten, das sich wie ein Kranz aus Flammen über ihren Schultern sammelte. Dann rissen aus diesem Licht zwei gewaltige Schwingen hervor, geformt aus strahlendem Blau, jede Feder wie aus reinem Feuer geschaffen. Sie waren nicht aus Fleisch und Knochen, sondern aus brennender Essenz, und doch wirkten sie greifbar und scharf wie Klingen.
Die Schwingen eines Blauen Phönix breiteten sich aus, jener gefährlichsten aller Phönixarten, deren Feuer nicht nur verbrennt, sondern verwandelt und richtet. Das Leuchten der Federn war durchzogen von helleren Adern, die wie Blitze durch das Blau liefen, und mit jeder langsamen Bewegung sandten sie Wellen aus Hitze und Druck in den Raum.
Der Kakeru wich zurück und riss die Arme hoch, um sein Gesicht vor dem gleißenden Licht zu verbergen. Er wandte den Kopf zur Seite und presste die Augen fest zusammen, geblendet von der unerwarteten Helligkeit, die wie eine brennende Welle über ihn hereinbrach. In dem kalten Blau verlor seine dunkle Gestalt ihre bedrohliche Größe. Was eben noch wie ein übermächtiger Koloss gewirkt hatte, erschien nun kleiner, fast gedrängt unter der unerbittlichen Strahlkraft, die ihn zurückzwang.
Die Höhle erzitterte unter der neu erwachten Macht, als antworte der Fels auf das Leuchten, das aus ihr hervorging. Das blaue Licht pulsierte im ruhigen, kraftvollen Rhythmus ihres Herzschlags, gleichmäßig und unaufhaltsam, und erfüllte den Raum mit einer Präsenz, die keinen Widerstand duldete.
Von diesem Augenblick an war Salyn nicht länger das wehrlose Mädchen, das in die Finsternis gezerrt worden war. In ihr war eine Macht erwacht, älter als ihre Angst und größer als die Gewalt ihres Gegners, und sie trug die Zeichen des Blauen Phönix, ohne ihre menschliche Gestalt zu verlieren.
Als der Krieger begriff, was sich vor seinen Augen vollzog, wich die erste Betäubung aus seinem Blick und machte kalter Entschlossenheit Platz. Mit einem rauen Laut fuhr seine Hand an die Seite, riss das Schwert aus der Scheide und hob es ohne Zögern gegen sie. In seiner Bewegung lag kein Zögern mehr, sondern der nackte Wille zu töten, als wolle er das Erwachen dieser Macht im Keim ersticken.
Salyn sah die Klinge im blauen Licht aufblitzen, und noch ehe der erste Schlag fiel, wusste sie, dass sie handeln musste. Mit einer fließenden Bewegung griff sie hinter ihre Schultern, dorthin, wo eben noch nichts gewesen war, und im selben Atemzug verdichtete sich das blaue Leuchten zu einem Schwert in ihrer Hand. Die Klinge war schlank und klar wie gefrorenes Feuer, und ihr Griff schmiegte sich warm in ihre Faust, als habe er nur auf diesen Augenblick gewartet.
Der erste Hieb des Kriegers brach mit brutaler Wucht auf sie herab. Sie riss die leuchtende Klinge hoch, und Stahl traf auf brennendes Blau. Der Aufprall ließ die Höhle erzittern. Funken sprangen wie glühende Splitter in die Dunkelheit, und ein scharfes Kreischen schnitt durch die feuchte Luft. Noch ehe der Nachhall verklungen war, drehte der Kakeru die Waffe und führte den nächsten Schlag, schneller, tiefer, unerbittlicher.
Salyn wich zur Seite, spürte den Luftzug der Klinge an ihrer Wange und konterte aus der Bewegung heraus. Ihre Füße fanden Halt auf dem unebenen Boden, als gehörte er ihr. Der Kakeru setzte nach, trieb sie mit einer Folge harter Schläge zurück, doch jeder Angriff traf auf eine präzise Abwehr. Ihre Klinge fing seinen Stahl ab, glitt daran entlang, lenkte ihn um, zwang ihn in neue Winkel. Es war kein zögerndes Lernen, sondern ein Erwachen von etwas, das längst in ihr geschlummert hatte.
Schlag auf Schlag prallten die Waffen aufeinander. Das blaue Leuchten warf zitternde Schatten an die Wände, und ihre Schwingen aus Feuer spannten sich hinter ihr wie lebendige Flammenbögen. Der Kakeru brüllte vor Wut und erhöhte das Tempo, doch seine Bewegungen wurden gröber, seine Kraft ungezielter. Salyn hingegen gewann an Ruhe. Ihre Atmung fand einen Rhythmus, der sich mit dem Puls des Lichtes vereinte.
Ein harter Stoß traf seine Klinge von unten und zwang sie hoch. Noch bevor er den Fehler erkannte, war sie bereits in der Drehung, ihre Schwingen wirbelten einen Sturm aus Hitze und Staub auf. Sie setzte nach, ließ ihm keinen Raum, trieb ihn Schritt für Schritt zurück. Sein Rücken stieß gegen den Fels, und für einen Herzschlag war seine Deckung offen.
Salyn fasste den Griff ihres Schwertes mit beiden Händen, hob die leuchtende Klinge über ihre rechte Schulter und bündelte in diesem Augenblick alles, was in ihr erwacht war. Das blaue Feuer entlang der Schneide verdichtete sich, wurde heller, heißer, beinahe weiß im Kern. Dann ließ sie die Klinge herabfahren.
Das Schwert traf ihn nicht wie Stahl auf Fleisch. Es durchdrang ihn wie ein Strahl reiner Glut. Ein greller Blitz erfüllte die Höhle, und für einen Herzschlag schien die Zeit selbst stillzustehen. Kein Blut floss. Kein Laut des Schmerzes hallte wider.
Dort, wo die Klinge ihn berührt hatte, brach das blaue Feuer aus und verschlang ihn in einem lautlosen, alles verzehrenden Leuchten. Seine massige Gestalt zerfiel nicht in einem Sturz, sondern löste sich von innen heraus auf, als werde sie von einer Hitze durchdrungen, die keine Spur zurückließ.
Als das Licht verebbte, blieb nur feiner, dunkler Staub zurück, der lautlos zu Boden sank und sich zwischen den Steinen verlor.
Salyn stand reglos da, das Leuchten noch immer pulsierend um sie. War dies Wirklichkeit oder ein Traum, geboren aus Furcht und Verzweiflung? War sie es gewesen, die eben gekämpft hatte, oder eine Macht, die nur durch sie gewirkt hatte?
Langsam öffneten sich ihre Finger, und sie ließ das Schwert fallen. Doch kein Aufprall war zu hören. Noch bevor die Klinge den Boden berührte, zerfiel sie in feinen, blauen Nebel, der sich in alle Richtungen verflüchtigte und schließlich vollständig im Dunkel der Höhle verschwand.
Angst überfiel sie plötzlich mit einer Wucht, die ihr den Atem nahm. Das Leuchten in ihrem Inneren war noch nicht ganz verklungen, doch an seine Stelle trat nun die Erkenntnis dessen, was geschehen war. Ohne sich umzusehen, wandte sie sich ab und rannte aus der Höhle, ihre Schritte hallten über den unebenen Boden, während hinter ihr nur noch Stille blieb.
Als sie ins Freie trat, umfing sie die kühle Nacht. Hoch über ihr standen die Sterne klar und fern am Firmament, als hätten sie von dem Geschehen unter dem Fels nichts bemerkt. Ihr ruhiges Licht wirkte beinahe grausam in seiner Unschuld, als sei diese Nacht nicht anders als jede andere. Der Wind strich über die Felsen und trug den Geruch von Stein und weiter Ferne mit sich.
Mit dem ersten Schritt ins Freie erlosch das blaue Leuchten vollständig. Die Hitze wich aus ihrem Körper, ihre Schwingen aus Feuer lösten sich lautlos in der Dunkelheit auf, und ihre Haare verloren das glühende Blau, bis sie wieder in ihrem vertrauten Rot schimmerten. Keine Spur der Verwandlung blieb sichtbar. Ihre Hände waren leer, ihre Haut unverletzt, und selbst das Zittern der Erde war vergangen. Nur ihr Kleid hing in Fetzen an ihr herab, zerrissen von dem Kampf und dem Griff ihres Gegners, ein stummes Zeugnis dessen, was geschehen war.
Vor der Höhle stand noch immer das Pferd des Fremden. Es hatte sich nicht entfernt, sondern wartete reglos zwischen den Felsen, als sei es an einen unsichtbaren Befehl gebunden. Im Licht der Sterne wirkte es noch größer, als es ihr zuvor erschienen war. Sein dunkles Fell verschluckte das Licht beinahe vollständig, nur an den Konturen zeichnete sich seine gewaltige Gestalt gegen den Himmel ab.
Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass dieses Tier aus dem Land der Glutus stammen musste. Man nannte diese Pferde Feuerhufe, schwere Arbeitspferde von gewaltiger Kraft, geschaffen für Zug und Last, und doch schneller als jedes gewöhnliche Reitpferd. Ihre Brust war breit und tief, ihre Schultern massiv, und in der Ruhe lag eine gespannte Energie, als warteten sie auf ein verborgenes Zeichen.
Im vollen Galopp, so erzählte man sich, schien es, als brenne ein unsichtbares Feuer unter ihren Hufen. Wenn sie in diesen Lauf verfielen, hinterließen sie keine Spuren im Staub und keinen Abdruck im weichen Boden, als trügen sie ihr eigenes Element unter sich. Manche behaupteten, sie berührten die Erde in jenem Moment kaum noch, sondern jagten wie ein Sturm darüber hinweg.
Salyn trat zögernd näher. Das Tier wandte den Kopf und betrachtete sie mit einem ruhigen, dunklen Blick, in dem weder Wildheit noch Widerstand lagen. Vorsichtig legte sie die Hand an seinen Hals. Das Fell war warm, und unter ihrer Berührung arbeitete eine Kraft, die sie nun besser verstand als zuvor.
Ohne weiter nachzudenken, schwang sie sich in den Sattel. Das Pferd bewegte sich erst, als sie die Zügel aufnahm und ihm die Richtung wies. Dann setzte es sich in Bewegung, zunächst in einem ruhigen Schritt, der sie von der Höhle forttrug.
Der Weg in Richtung Heimat lag dunkel vor ihr, doch sie wusste, dass sie nicht länger dasselbe Mädchen war, das in diese Felsen gezerrt worden war. Hinter ihr blieb die Höhle stumm und schwarz, als habe sie das Geheimnis in sich verschlossen, und vor ihr dehnte sich die Nacht, still und weit, unter dem unerschütterlichen Glanz der Sterne.
Die Leute in Kumada, die den Überfall miterlebt hatten, konnten nicht begreifen, was soeben geschehen war. Noch vor wenigen Augenblicken hatten die schwarzen Reiter den Platz beherrscht. Ihre Pferde hatten mit schnaubenden Nüstern den Boden aufgerissen, Hufe hatten über das Pflaster gedonnert, Mäntel waren im Wind geflattert. Dann, beinahe so plötzlich wie sie aufgetaucht waren, jagten sie davon.
Ein letzter Aufschrei, das Kreischen eines Kindes, das Klirren umgestoßener Körbe, und die Reiter verschwanden zwischen den Häusern am Rand des Marktes. Zurück blieb eine Staubwolke, die sich nur langsam legte. Noch einige Herzschläge lang hörte man das Echo der Hufe, das in den Gassen widerhallte, bis auch dieses Geräusch verklang und eine unnatürliche Stille zurückließ.
Fast alle waren wie benommen, kaum jemand konnte einen klaren Gedanken fassen. Der Marktplatz glich einem Schlachtfeld. Zerrissene Tuchbahnen hingen schief von ihren Stangen. Obst rollte über den Boden und wurde achtlos zertreten. Ein umgestoßener Wagen lag auf der Seite, das Rad drehte sich noch knarrend im Wind. Zwischen zerbrochenen Kisten lagen verstreute Waren, Brotlaibe im Staub, zertrampelte Kräuter, verschüttetes Getreide.
Ein Händler kniete neben seinem Stand und starrte fassungslos auf die Trümmer. Eine alte Frau weinte leise, während zwei Männer versuchten, einen Verletzten aufzurichten. Andere liefen planlos durcheinander, riefen Namen, suchten nach Angehörigen oder schrien durcheinander, ohne einander zuzuhören.
Niemand wusste, was genau geschehen war. Alles war zu schnell gegangen. Die Erinnerung an schwarze Mäntel und kalte Stimmen mischte sich mit der Angst, dass die Reiter vielleicht zurückkehren könnten.
Erst nach und nach drang die Wirklichkeit durch den Schleier der Panik. Wie aus einem bösen Traum erwachten die Menschen und sahen einander ratlos an. Die Stille hielt nie lange an. Sie wurde von hastigen Stimmen durchbrochen, von aufgeregten Fragen und gegenseitigen Vorwürfen.
Wer hatte die Reiter zuerst gesehen?
Warum hatte niemand sie aufgehalten?
Hatten sie etwas oder jemanden mitgenommen?
Einige schrien durcheinander, andere redeten so leise, als fürchteten sie, die schwarzen Gestalten könnten sie noch hören. Ein Mann behauptete, es seien mindestens zehn gewesen. Eine Frau widersprach heftig und bestand darauf, es seien nur fünf gewesen. Niemand wusste etwas Genaues und doch glaubte jeder, etwas Wichtiges gesehen zu haben.
Zwischen all den Stimmen lag die spürbare Angst, dass dies erst der Anfang gewesen sein könnte. Manche blickten nervös zu der Gasse, in der die Reiter verschwunden waren, als erwarteten sie ihre Rückkehr.
So vergingen weitere Minuten im unruhigen Treiben des Marktplatzes, bis schließlich die Forderung erhoben wurde, die Schandarmen herbeizurufen. Ein junger Mann löste sich aus der Menge und eilte mit schnellen Schritten davon, während hinter ihm die Stimmen weiter durcheinander klangen und niemand imstande war, das Geschehene in klare Worte zu fassen. Staub lag noch immer über den Pflastersteinen, und zwischen umgestürzten Ständen und verstreuten Waren standen die Menschen wie aus einem jähen Traum erwacht, unsicher, ob die Gefahr wirklich vorüber sei.
Nicht lange danach erschienen die Ordnungskräfte am Eingang des Platzes. In straffer Ordnung schritten sie heran, ihre Gewänder vom Weg gezeichnet, ihre Haltung aufrecht und gesammelt. An ihrer Spitze ging Odan, dessen Blick mit wacher Strenge über das Bild der Verwüstung glitt. Er nahm jedes Detail in sich auf, die zerbrochenen Kisten, die verängstigten Gesichter, die Spuren der Hufe im Staub. Dann trat er vor und erhob seine Stimme, die fest und tragend über den Platz hallte.
„Bitte bewahrt Ruhe und bleibt an eurem Platz. Niemand verlässt den Markt, bis wir die Lage geklärt haben.“
Seine Worte legten sich wie eine feste Hand auf das aufgewühlte Geschehen und geboten dem ungeordneten Stimmengewirr Einhalt. Nach und nach verstummten die Rufe, und das hastige Durcheinander wich einer angespannten Stille, in der jedes weitere Wort Gewicht erhielt. Zwei seiner Gefährten begannen daraufhin, die Menge mit ruhiger Entschlossenheit zu ordnen und freie Wege zu schaffen, damit die Verletzten versorgt und die Aussagen der Zeugen in geordneter Weise aufgenommen werden konnten. Andere sicherten die angrenzenden Gassen und hielten wachsamen Blick auf jede Bewegung. Die Ordnung kehrte nicht schlagartig zurück, doch sie nahm Gestalt an wie ein Gefüge, das sich aus dem Chaos erhebt.
Odan stellte sich in die Mitte des Platzes und begann mit ruhiger Entschlossenheit, die Anwesenden zu befragen. „Wer von euch hat die Reiter zuerst gesehen? Aus welcher Richtung kamen sie, und wie viele waren es?“ Die Antworten wurden nacheinander gegeben, wie er es verlangte, und ein Schandarme hielt jede Aussage sorgfältig fest. Widersprüche wurden geprüft, Beobachtungen verglichen, und selbst unscheinbare Einzelheiten fanden Beachtung, denn Odan wusste, dass in ihnen der Schlüssel zur Wahrheit liegen konnte.
Währenddessen untersuchten seine Männer die Spuren im Staub und die Zeichen der Verwüstung. Tiefe Hufabdrücke zeugten von kräftigen Tieren, die mit großer Geschwindigkeit über den Platz gejagt waren. Abgebrochene Holzstücke und zerrissene Stoffbahnen wurden zur Seite geräumt, damit nichts Wichtiges übersehen werde. Schritt für Schritt gewann die Ordnung die Oberhand über die Verwirrung.
Als die ersten Berichte gesammelt waren, ließ Odan die Namen der Anwesenden feststellen und fragte mit ernster Stimme, ob jemand vermisst werde. Familien traten zusammen, Eltern riefen nach ihren Kindern, und die Verletzten wurden gezählt. In diesem geordneten Vorgang, der Sicherheit schaffen sollte, offenbarte sich plötzlich eine Lücke, die sich nicht schließen ließ.
„Salyn“, sagte eine Frau mit unsicherer Stimme, „ich habe sie vor dem Angriff noch hier am Stand gesehen.“
Odan wandte sich ihr zu und fragte beherrscht: „Habt Ihr beobachtet, wohin sie gegangen ist oder wen sie zuletzt an ihrer Seite hatte?“
Die Frau senkte den Blick. „Nein. Als die Reiter den Platz stürmten, verlor ich sie aus den Augen.“
Ein weiterer Dorfbewohner trat vor und sprach mit gedämpfter Stimme: „Ich meine gesehen zu haben, dass einer der Reiter jemanden mit sich führte.“ Seine Worte waren von Unsicherheit getragen, doch sie fielen in eine Stille, die ihnen umso größeres Gewicht verlieh.
Für einen flüchtigen Augenblick verhärteten sich Odans Züge, und ein Schatten trat in seinen Blick. Dennoch blieb seine Haltung aufrecht und von innerer Sammlung getragen. Er antwortete mit ruhiger, doch unerschütterlicher Festigkeit: „Wir werden jede Spur aufnehmen und ihr folgen, wohin sie auch führt. Niemand in diesem Dorf wird im Stich gelassen, und niemand gibt die Suche auf.“
In diesem Augenblick war er zugleich Hüter der Ordnung und Vater, dessen Herz schwer geworden war. Doch er ließ keinen Zweifel daran, dass seine Pflicht und seine Entschlossenheit stärker waren als die Furcht. Unter seiner Führung begann die Suche nicht als Ausdruck blinder Hast, sondern als wohlgeordnete Anstrengung, getragen von Disziplin und dem festen Willen, das Verlorene zurückzuholen.
Mit einem Mal breitete sich eine neue Unruhe aus, diesmal gezielter und kälter. Nun wusste man, wen die schwarzen Reiter entführt hatten. Ohne weiteres Zögern stellte man einen Suchtrupp zusammen. Männer griffen nach Laternen, nach Seilen und Stöcken, einige sattelten hastig ihre Tiere. Weit konnten die Reiter mit ihren schweren Arbeitstieren noch nicht gekommen sein, redete man sich ein, auch wenn insgeheim viele fürchteten, dass diese Hoffnung trügerisch war.
Der Suchtrupp bestand aus mehren Freiwilligen, die sich unter der Führung der Schandarmen in die umliegenden Felder und Wälder verteilten. Mit ernster Entschlossenheit durchkämmten sie Wiesen und Hohlwege, prüften weichen Boden auf Spuren und suchten die Ränder der Straßen nach jedem noch so geringen Hinweis ab. Jeder von ihnen wusste, dass Zeit nun von entscheidender Bedeutung war, und so scheute keiner die Mühe, auch entlegenste Winkel zu untersuchen.
Doch je weiter sich die Suche ausdehnte, desto drückender wurde die Erkenntnis, dass sich keine Fährte finden ließ. Als die Sonne sich bereits neigte und ihr Licht länger und matter über das Land fiel, war noch immer kein Zeichen der Reiter entdeckt worden. Es schien beinahe, als seien sie nur eine Erscheinung gewesen, die sich auf dem Marktplatz gezeigt und sogleich wieder im Nichts aufgelöst hatte. Weder ein schwarzes Pferdehaar noch ein erkennbarer Hufabdruck fand sich jenseits der Dorfgrenzen, und selbst im weichen Erdreich der Felder blieb der Boden unberührt.
Dennoch dachte niemand daran, die Suche abzubrechen. Die Männer sprachen nur wenig, doch in ihren Gesichtern lag derselbe unbeugsame Wille. Sie wussten, wie viel Salyn ihrem Vater bedeutete, und sie kannten Odan als einen Mann, der seine Pflicht mit unbeirrbarer Treue erfüllte. Der Gedanke, ihm ohne Nachricht von seiner Tochter gegenüberzutreten, wog schwerer als jede Müdigkeit. So durchmaßen sie weiter das Land, Schritt um Schritt, getragen von der Hoffnung, dass selbst eine verborgene Spur sich noch zeigen möge.
Als Salyn schließlich die ersten Felder von Kumada erreichte, lag die Nacht bereits über dem Land. Ein kühler Hauch strich über die Äcker, und das Dunkel wurde nur vom fahlen Licht der Sterne durchbrochen, die hoch und unnahbar am Himmel standen. Zwischen Hecken und Feldrainen bewegten sich gedämpfte Schatten, denn die Männer des Suchtrupps hatten Fackeln entzündet, deren Flammen im Wind flackerten und lange, tanzende Lichter über den Boden warfen.
In der Ferne bemerkten sie plötzlich ein rasches Näherkommen, begleitet vom rhythmischen Klang von Hufen auf festem Grund. Kurz darauf sprühten Funken über den steinigen Untergrund, und das Licht der Fackeln fing sich im Glanz eines dunklen Pferdeleibes. Die Männer hielten inne und umfassten ihre Lanzen und Stäbe fester, denn sie waren bereit, einer neuen Gefahr zu begegnen. Einer trat vor und hob die Fackel höher, um die Gestalt deutlicher zu erkennen, während ein anderer sich seitlich stellte, um dem Reiter den Weg abzuschneiden, falls es nötig werden sollte.
Als die Reiterin in den vollen Schein der Flammen ritt, offenbarte sich ihr Gesicht, bleich vom Ritt, doch wach und entschlossen. Ein Murmeln ging durch die Reihen, und mehrere Männer traten unwillkürlich einen Schritt näher. Einer von ihnen rief ihren Namen mit stockender Stimme, als könne er noch immer nicht glauben, was er sah.
Salyn brachte das Pferd zum Stehen und glitt rasch aus dem Sattel. Ihre Knie gaben für einen Augenblick nach, doch sie fing sich und legte beruhigend die Hand an den Hals des Tieres, dessen Flanken vom schnellen Lauf bebten.
„Ich bin entkommen“, sagte sie gefasst, auch wenn ihr Atem noch unruhig ging. „Sie werden nicht so schnell zurückkehren.“
Die Männer traten zu ihr und prüften mit sorgsamer Aufmerksamkeit, ob sie Verletzungen davongetragen habe. Einer nahm behutsam ihre Hand und hielt sie ins flackernde Licht der Fackeln, um nach Spuren von Blut oder Schmerz zu suchen. Ein anderer bemerkte ihr Frösteln und legte ihr ohne viele Worte seinen Umhang um die Schultern, damit das zerrissene Kleid bedeckt und sie vor der nächtlichen Kühle geschützt werde. Ein dritter nahm die Zügel des Pferdes an sich und musterte das Tier mit prüfendem Blick, als könne es selbst Auskunft über das Geschehene geben.
Währenddessen bestimmte einer der Männer einen schnellen Läufer, der sich unverzüglich auf den Weg machen sollte, um Odan von Salyns Rückkehr zu unterrichten. Ohne Zögern wandte sich der Bote ab und verschwand zwischen den dunklen Feldwegen, während die übrigen ihre Aufmerksamkeit wieder dem Mädchen zuwandten. Die eben noch spannungsvolle Erwartung, die in jedem Atemzug gelegen hatte, löste sich nicht in unbedachte Freude auf, sondern verwandelte sich in ruhige, zielgerichtete Tätigkeit.
Die Männer ordneten sich um Salyn in einem schützenden Kreis, einige mit erhobenen Fackeln, andere wachsam in die Dunkelheit blickend, als könnten die Schatten selbst eine Bedrohung bergen. Einer führte das Pferd am Zügel, ein anderer ging dicht an ihrer Seite, bereit, sie zu stützen, falls die Erschöpfung sie übermannen sollte. So setzten sie sich gemeinsam in Bewegung und wandten ihre Schritte dem Weg nach Kumada zu. Die Unruhe der vorangegangenen Stunden wich einer stillen Entschlossenheit, die sie nun miteinander verband. Nicht länger trieb sie die rastlose Suche voran, sondern die dankbare Gewissheit, Salyn lebend wiedergefunden zu haben und sie nun unter ihrem Schutz sicher in die Heimat zurückzuführen.
Nicht lange darauf näherte sich Odan aus der Dunkelheit des westlichen Feldweges. Er war unter den Letzten, die eintrafen, da ihn die Suche weiter hinausgeführt hatte als die anderen. Als er die Gruppe im Schein der Fackeln erblickte und die Gestalt seiner Tochter erkannte, die in einen fremden Umhang gehüllt zwischen den Männern stand, hielt er unwillkürlich inne. Für einen Atemzug verharrte er, als müsse er sich vergewissern, dass nicht ein Trugbild seine Sinne täusche.
Dann trat er mit raschen Schritten auf sie zu. Alle Strenge, die ihn während der Suche getragen hatte, wich aus seinem Gesicht. Ohne ein Wort schloss er sein Kind in die Arme und zog den Umhang fester um ihre Schultern, als wolle er sie selbst vor allem Unheil bewahren. In dieser Umarmung lag eine Erleichterung von solcher Tiefe, dass keine Rede sie hätte ausdrücken können, und die Männer, die ringsum standen, senkten in stillem Respekt die Blicke.
Als die ersten Fragen an sie gerichtet wurden, antwortete Salyn mit einer Stimme, die ruhig und beherrscht klang, obgleich die Erschöpfung noch in ihr nachhallte. Sie wählte ihre Worte mit Bedacht und ließ nichts von dem inneren Aufruhr erkennen, der sie in der Höhle ergriffen hatte. Mit gesenktem Blick berichtete sie, dass einer der Soldaten für einen kurzen Moment die Aufmerksamkeit verloren habe und sie diesen Augenblick genutzt habe, sich aus seinem Griff zu lösen.
Sie erzählte weiter, sie habe in der Nähe ein Pferd angebunden gesehen und ohne Zögern die Zügel ergriffen. Das Tier sei unruhig gewesen, doch es habe ihren festen Griff gespürt und sich von ihr führen lassen. In der Dunkelheit habe sie den schmalen Pfad verlassen und sei über steinigen Grund geritten, damit ihre Verfolger keine klare Spur aufnehmen konnten. Das Feuer der Hufe auf dem Fels habe sie selbst erschreckt, doch es sei ihr gelungen, die Richtung mehrfach zu wechseln und schließlich in das offene Gelände hinauszugelangen.
Sie fügte hinzu, dass die Soldaten, eines ihrer Pferde beraubt, gezwungen gewesen seien, ihren Weg zu Fuß oder mit geringerer Geschwindigkeit fortzusetzen. Dadurch habe sie einen Vorsprung gewonnen, der ihr die Rückkehr ermöglicht habe. Ihre Darstellung blieb sachlich und frei von Ausschmückung, als berichte sie von einem Geschehen, das allein von kluger Überlegung und günstigen Umständen getragen worden sei.
Von dem, was sich im Innern der Höhle zugetragen hatte, sprach sie nicht. Sie verschwieg die Worte, die sie dort gehört, und die Blicke, die sie getroffen hatten. In ihrem Innern war sie überzeugt, dass niemand ihr Glauben schenken würde, wenn sie von jenen dunklen Vorgängen berichtete, die sich fernab menschlicher Zeugen ereignet hatten. So bewahrte sie das Erlebte in der Stille ihres Herzens und ließ nur so viel ans Licht treten, wie notwendig war, um ihre Rückkehr zu erklären.
Allmählich kehrte in Kumada wieder Ruhe ein, und das Leben nahm seinen gewohnten Lauf auf. Die Felder wurden bestellt, der Markt füllte sich erneut mit Waren und Stimmen, und die Erinnerung an den Überfall trat Schritt für Schritt hinter die täglichen Pflichten zurück. Die Häuser standen wieder offen wie zuvor, und das vertraute Geräusch von Wagenrädern auf dem Pflaster mischte sich mit dem Rufen der Händler, als sei nichts geschehen.
Für Salyn jedoch war nichts mehr ganz so wie zuvor, denn das Erlebte hatte in ihr einen Entschluss reifen lassen, der nicht mehr wich.
Eines Abends trat sie vor ihren Vater und bat ihn, sie in die Kunst des Kampfes einzuweisen. Sie sprach nicht aus Furcht, sondern aus ruhiger Entschlossenheit, die aus innerer Klarheit geboren war. Odan erkannte den Ernst in ihrem Blick und prüfte sie mit einigen Fragen, ob ihr Wunsch aus einem flüchtigen Impuls entsprungen sei oder aus wahrer Überzeugung. Als er spürte, dass ihre Entscheidung feststand, gewährte er ihr die Bitte.
Von da an trafen sie sich an jedem Tag auf einer freien Fläche am Rand des Dorfes, wo der Boden eben war und der Blick weit über die Felder reichte. Zunächst lehrte er sie die Haltung des Körpers, denn er sagte, dass jede Kraft aus der Standfestigkeit erwachse. Sie lernte, die Füße sicher zu setzen, das Gewicht gleichmäßig zu verteilen und den Atem ruhig zu führen. Lange Zeit bestand das Üben nur aus Wiederholungen einfacher Bewegungen, aus dem Heben und Senken der Arme, aus dem bewussten Drehen des Oberkörpers, bis jede Regung klar und kontrolliert war.
Erst als ihre Haltung gefestigt war, reichte er ihr einen hölzernen Übungsstab. Mit ihm zeigte er ihr die Grundstellungen der Abwehr und des Angriffs. Er führte die Bewegungen langsam vor, damit sie den Fluss der Kraft erkennen konnte, der nicht aus Hast, sondern aus Sammlung entsteht. Wenn sie ungeduldig wurde, hielt er sie an und sprach mit ruhiger Stimme, dass wahre Stärke nicht im raschen Schlag liege, sondern in der Beherrschung des Augenblicks.
Bald übten sie auch einfache Zweikämpfe, bei denen Odan ihre Angriffe prüfte und ihre Deckung herausforderte. Er schlug nicht hart, doch seine Bewegungen waren präzise und fordernd. Jeder Fehler wurde sichtbar, jeder unachtsame Schritt offenbarte eine Lücke. Salyn fiel mehr als einmal zu Boden, doch sie erhob sich ohne Klage und nahm erneut Haltung an. Mit der Zeit gewann sie an Geschmeidigkeit, ihre Schritte wurden sicherer, ihr Blick klarer.
So lernte sie Disziplin, Ausdauer und die Einheit von Körper und Geist, und das tägliche Üben wurde ihr bald mehr als bloße Unterweisung in einzelnen Techniken. Es war ein Weg innerer Formung, auf dem jede Bewegung ihren Sinn erhielt und jeder Atemzug Teil einer größeren Ordnung wurde. In der geduldigen Wiederholung der Abläufe wuchs ihre Kraft, und in der Stille zwischen den Schlägen fand sie eine Gewissheit, die nicht aus Übermut, sondern aus Klarheit erwuchs. Die Zeit verging, und mit jedem Tag reifte in ihr eine Stärke heran, die aus Erfahrung geboren war und von stillem, unbeirrbarem Willen getragen wurde.
Salyn lernte mit einer Schnelligkeit, die selbst ihren Vater in nachdenkliches Staunen versetzte. Schon nach wenigen Monaten unermüdlichen Trainings führte sie das Schwert mit einer Sicherheit und Anmut, wie sie sonst nur bei gereiften Meistern zu finden war. Ihre Bewegungen waren präzise und zugleich fließend, ihr Blick wach und vorausschauend, als erkenne sie den Verlauf eines Gefechts, noch ehe es begonnen hatte. Bald zeigte sich, dass sie nicht mehr auf jene geheimnisvolle Wandlung angewiesen war, die sie einst in der Höhle erfahren hatte. Auch ohne diesen Zustand innerer Verwandlung trat sie in Übungskämpfen gegen die Jungen des Dorfes an und bezwang sie mit ruhiger Überlegenheit. Kein Zweikampf endete zu ihren Ungunsten, und noch hatte sie keinen Kampf verloren.